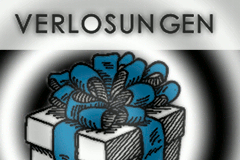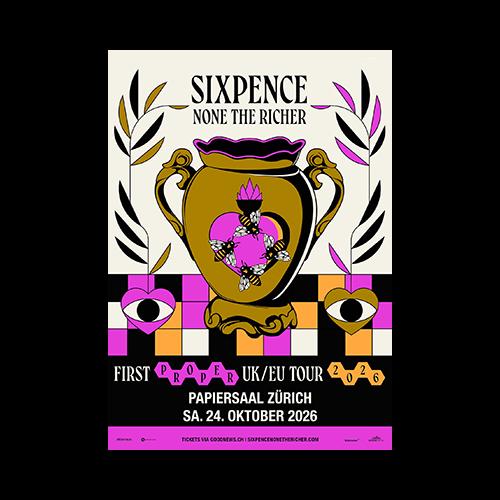Stefan Haupt: «Man muss wirklich herausfinden, was das Herzstück oder der Kern der Geschichte ist»

Schon für sein Debüt «Utopia Blues» durfte Regisseur Stefan Haupt Preise in Empfang nehmen. Mit dem gleichnamigen Dok-Film «Elisabeth Kübler-Ross» widmetet er sich dem Leben und Wirken der gleichnamigen Sterbeexpertin und mit «Zwingli» brachte er ein Stück Schweizer Geschichte auf die Leinwand. Mit dem aktuellen Film hat sich Stefan Haupt das Leben wahrlich nicht leicht gemacht. Er widmete sich einer Adaption des Literaturklassikers «Stiller» von Max Frisch. Der Roman galt lange als schwierig zu verfilmen. Wie geht man an so einen Roman ran? Wir konnten mit Stefan Haupt über die Arbeit am Film sprechen.
Bäckstage/Mike Mateescu: Ich sehe Parallelen zwischen «Stiller» und deinem Debütfilm «Utopia Blues». Letzterer verhandelt Themen wie den Dialog zwischen den Generationen und Selbstverwirklichung. Wir erleben zunehmend, dass alte Regeln nicht mehr gelten oder funktionieren. Flossen Gedanken zur Generation Z in dein aktuelles Werk?
Stefan Haupt: Daran habe ich nicht speziell gedacht. Ich war aber positiv überrascht, dass mehrere junge Leute, die am Film mitgearbeitet haben, irgendwann ankamen und sagten: «Hey, es ist so super, wie aktuell Roman und Drehbuch sind.» Wir haben nicht versucht, forciert modern zu sein, denn mich verblüfft die Aktualität des Romans, die Aktualität seiner Themen sowieso. Nur schon dieser Satz: «Du sollst dir kein Bildnis machen.» Unser Wunsch: «Ich möchte ein anderer sein. Ich möchte selber das Bild von mir bestimmen.» Das ist alles hochaktuell.
Eine weitere Verbindung, die ich zwischen den beiden Filmen erkenne, ist das Aufbegehren gegen Konformität. War das für «Stiller» auch ein zentrales Thema?
Ich finde, in «Utopia Blues» gibt es dieses Aufbegehren gegen die Konformität der Gesellschaft, ja. Und darin steckt dann natürlich auch: Lasst mich meinen eigenen Weg gehen. In «Stiller» empfinde ich, dass das Thema näher an die eigene Individualität angebunden ist. Nicht so sehr generell gegenüber der Gesellschaft, sondern Stiller gegenüber Julika, und gegenüber sich selbst. Und das ist heutzutage ja eine ganz grosse Frage. Gerade auch für junge Menschen, mit ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst, mit dem Gefühl von Unzulänglichkeit im Vergleich zu ihren Vorbildern. Es ist auch eine fragwürdige Situation, dass wir über die sozialen Medien wahnsinnig viele Kontakte haben können und man gleichzeitig schon fast von der Pandemie der Einsamkeit spricht, die mit dem übersteigerten Kreisen um sich selbst zu tun hat. Und letztlich ist Stiller jemand, der um sich selbst kreist und in diesem Netz gefangen ist. In dieser Hinsicht gibt’s natürlich einen Bezug.
 Stefan Haupt gibt am Set von «Stiller» Regieanweisungen. (© 2025 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.)
Stefan Haupt gibt am Set von «Stiller» Regieanweisungen. (© 2025 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.)
Du hast dieses Drehbuch gemeinsam mit Alex Buresch verfasst. Der Roman ist ja in Tagebuchform verfasst. Worauf habt ihr bei eurer Adaption geachtet?
Es gab im Prinzip zwei Grundhaltungen, die wir einnehmen wollten. Erstens respektieren und schätzen wir den Roman, und alles, was darin antreffen ist, als Grundlage. Die verschiedenen Ebenen der Zeit etwa, oder die Figuren, die wir hier vorfinden. Die müssen wir nicht neu erfinden. Die haben so einen starken Eindruck hinterlassen, dass wir von ihnen ausgehen wollten. Andererseits wollten wir dem Text nicht hörig sein wie eingeschüchterte Häschen und uns auch Freiheiten erlauben. So haben wir unseren Weg gesucht. Und dann ist es ähnlich wie beim Schnittprozess eines Dokumentarfilms, wo man fünfzig Stunden Material hat und am Schluss auf anderthalb Stunden kommen muss. Man muss ganz Vieles weglassen. Oder anders gedacht: Man muss wirklich herausfinden, was das Herzstück oder der Kern der Geschichte ist. Einerseits ist der Roman voll von ganz vielen grossartigen Geschichten und Fantastereien – manchmal über viele Seiten hinweg. Da wussten wir, dass wir das weitgehend weglassen mussten. Sonst wäre das kein Film, sondern quasi ein Hörbuch mit Bebilderung geworden. Also konzertierten wir uns auf die Handlungen und das Quartett der Beziehungen von Stiller, White, Rolf und Sybille. Und so haben wir gearbeitet, gesucht und geformt …
In jener Szene, wo Stiller seine Skizzen verbrennt, kam mir ein Gedanke. Kann es sein, dass Frisch in dem Roman Zweifel darüber verarbeitete, ob er ausserhalb der Architektur akzeptiert werden würde? Etwa als Schriftsteller? Weil er inzwischen als Architekt etabliert war? Könnte etwas davon in den Roman geflossen sein? War es vielleicht sogar der wahre Beweggrund, diesen Roman zu schreiben?
Das ist ein neuer Gedanke, den ich so noch nicht kenne, den ich aber spannend finde. Ich weiss, dass Frisch ein unglaublich selbstkritischer Mensch gewesen war, der sich hinterfragte und immer wieder zutiefst verunsichert war. Mich überraschte auch, wie oft er fertige Manuskripte seinen Kollegen zum Lesen gab, weil er unsicher war, ob sie gut genugseien oder ob er sie überarbeiten sollte. Das waren sicher Themen, die ihn zeitweise umgetrieben haben. Aber sicher war dies nicht die alles bestimmende Grundmotivation für diesen Roman. Schreiben ist ganz generell etwas Fantastisches, wenn man die inneren Kanäle öffnen kann. Wenn man Dinge, die im echten Leben vielleicht stocken und unlösbare Schwierigkeiten bereiten, anhand der Figuren, die man erfunden hat, umkehren oder sogar lösen kann. Oder Fährten mit einer Konsequenz verfolgen, wie man es im echten Leben nicht macht.
Du bist ein Regisseur von Dokumentationen und Spielfilmen. Bevorzugst du eine der beiden Formen?
Ich bin sehr glücklich, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, beide Genres zu machen. Eigentlich überlege ich mir sehr selten, was jetzt als nächstes kommen soll. Es ist fast wie ein Geschenk, dass ich immer sehr genau spüre, ob da bei einem neuen Thema genug Fleisch am Knochen ist. Ob mich das wirklich interessiert und ich das jetzt machen will. Ich erachte es als grosses Privileg, dass ich jene Filme machten konnte, die mich inhaltlich interessierten und deren Themen mich packten. Das war zum Beispiel im Fall von «Elisabeth Kübler-Ross» so und wurde logischerweise eine Dokumentation. Bei «Utopia Blues» oder jetzt «Stiller» war’s klar, dass dies Spielfilme sein würden. Und dabei hat mir geholfen, dass ich die Schauspielakademie als Theaterpädagoge machte und grosse Lust habe, mit Schauspieler:innen zu arbeiten, ihre Arbeitsprozesse kenne. Denn ich genoss drei Jahre Training als Schauspieler und kenne deswegen ihre Arbeitsprozesse gut. Und dann ist da sowieso ein genuines Interesse an Menschen und Geschichten, – und das zeigt sich bei beiden Filmarten.
«Stiller« läuft ab dem 16. Oktober in den Schweizer Kinos.
Das Interview wurde am 28. September 2025 im Rahmen des Zürich Film Festivls im Dolder Grand in Zürich geführt.