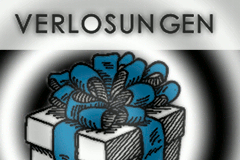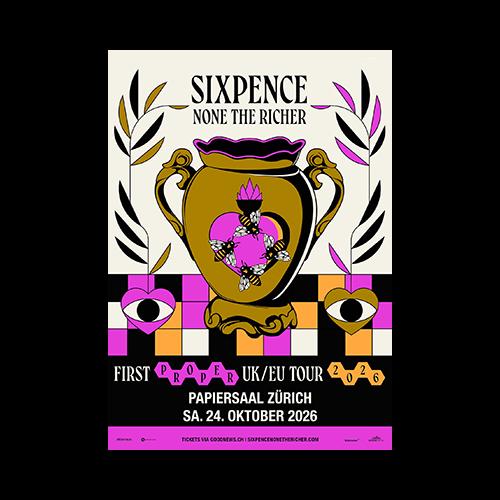Max Simonischek: «Es ist unbezahlbar, wenn man einen persönlichen Zugang zu den Geschichten hat, die man erzählt»
Max Simonischek ist fest in der Schweizer Filmlandschaft verwurzelt, hat etwa die Titelrolle in «Zwingli» gespielt oder wurde bei «Am Hang» von Regisseur Markus Imboden dirigiert. Max ist in Berlin geboren, hat lange in der Schweiz gelebt und ist als Schauspieler sowieso eine Art Nomade, der schon mal für eine Rolle den Lebensmittelpunkt ändert. In «Stiller» verkörpert er den Staatsanwalt Rolf Rehberg. Im Interview spricht er über den Film, aber auch über seinen Job.
Bäckstage/Mike Mateescu: Ein sehr feinfühliger Film, und gewissermassen die Antithese zur gegenwärtigen Kinolandschaft – auf die beste Art und Weise. Keine Action, keine Jokes und keine übermässige Dramatik. «Stiller» nimmt sich Zeit zu Atmen und geht auf seine Themen ein. Was bedeutet dieser Film für dich und was hat dich zu diesem Projekt gezogen?
Max Simonischek: Das liegt an Stefan Haupt, der in diesem Film sein eigenes Zeitgefühl etabliert, sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt und diesem auch genügend Zeit einräumt. Das Thema ist von Max Frisch gewählt. Das Ich in Bezug auf die Gesellschaft. Wo ist meine Position in der Gesellschaft? Das hast du bei vielen Weltliteraten, wie zum Beispiel Kafka. Zu welcher Gruppe gehöre ich, oder möchte ich dazugehören? Wie werde ich über die Gesellschaft definiert und wie definiere ich mich selbst? Kann ich mich meiner Schuld und Verantwortung entledigen? Kann ich neu anfangen? Das ist das grob umrissene Thema des Romans, und diese Themen werden erzählt durch die Beziehungen, die die Figuren untereinander eingehen. Und Stefan schafft es so schön in allen seinen Filmen, diese Beziehungen wirklich zu sezieren und ihnen die gewisse Aufmerksamkeit während seiner Arbeit zu geben. Er probt sehr gerne, was für Filmarbeitende nicht selbstverständlich ist, da es Zeit kostet – und Zeit Geld ist. Es finden sehr viele Gespräche statt – zum Teil auch philosophische. Er schafft am Set eine Stimmung, die eben nicht geprägt ist von Explosionen und Jokes, sondern von einer konzentrierten, ernsthaften Auseinandersetzung mit den Dialogen, Figuren und Themen. Das ist gleichzeitig auch das, was mich reizt, mit ihm als Künstler zusammenzuarbeiten. Natürlich habe ich auch mal gerne, wenn’s kracht oder ich in einer Komödie spiele. Aber es ist eben schwieriger, jemanden zu finden, der diesen Aufwand betreibt und das Ganze vielleicht erstmal trockener rüberkommt, als wenn ein Schenkelklopfer den nächsten jagt oder ein Auto nach dem anderen in die Luft fliegt. Doch dieses Vertrauen zu haben – ich spreche übrigens auch vom Theater – in das schauspielerische Spiel, in die Zusammenhänge der Figuren, ohne dass man Effekte reinballern muss, ist so schön. Das in einem Regisseur zu haben, ist immer gewinnend für mich.
Eins der Themen, dich ich bei diesem Film herausspürte, ist Stillers Aufbegehren gegen Konformität. Heute würde man sagen, dass er alle ghostet. Er ist plötzlich nicht mehr da. War Konformität für dich auch ein relevantes Konzept dieses Films?
Finde ich absolut ein Thema, mit dem man sich auch privat auseinandersetzt. Als Schauspieler versucht man ja immer, einen persönlichen Zugang zu einem Film oder Buch zu bekommen. Was kann ich damit anfangen? Wovon erzähle ich da? Hat das was mit mir zu tun? Und ich finde, eine essentielle Frage in dem Film – aber auch im Leben – ist; wie sehr wird dir von der Gesellschaft vorgegeben, wie du zu leben hast? Musst du heiraten? Musst du zwei Kinder haben? Musst du in einem Einfamilienhaus leben? Du wirst ja beispielsweise steuerlich begünstigt, wenn du heiratest. Und dieses gesellschaftliche Korsett zu spüren, ist mir durchaus bekannt und ist eigentlich ständig präsent. Weil man sich ständig fragt; ist es wirklich das, was du willst? Oder wurde dir das vorgelebt von deinen Eltern? Ist es nur deswegen? Und daran kann man zugrunde gehen. Ist es ein Bedürfnis von dir oder wurdest du so erzogen? Im weitesten Sinne auch von der Gesellschaft. Das ist eben auch ein Thema in diesem Film. Es ist ein Thema von Stiller und ebenso von Max Frisch. In all seinen Werken, die ich gelesen habe, taucht das immer wieder auf. Die Dialektik von Individuum und Gesellschaft. Kunst fängt dort an, wo man begreift, dass man im Widerspruch zur Gesellschaft steht – in jeweils unterschiedlichen Ausmassen. Das ist das Thema in «Stiller», und zu einem grossen Teil auch in meinem Leben.
Ich habe «Stiller» das erste Mal in meiner Schulzeit gelesen. Da war ich zugegebenermassen noch etwas zu jung dafür. Wobei sich das jetzt zu allgemein anhört. Ich hatte zu wenig Lebenserfahrung.
Dann war Max Frisch jemand, der einen Einfluss auf dich gehabt hat?
Absolut. Ich habe «Stiller» das erste Mal in meiner Schulzeit gelesen. Da war ich zugegebenermassen noch etwas zu jung dafür. Wobei sich das jetzt zu allgemein anhört. Ich hatte zu wenig Lebenserfahrung. Ich wusste nicht so genau, wovon er da schreibt. Aber in Vorbereitung auf den Film las ich es noch ein zweites und drittes Mal, und konnte dann schon viel mehr damit anfangen. Von daher hatte er schon einen Einfluss, aber nicht mehr als Kafka oder andere Weltliteraten, von denen sich viele mit der Frage nach dem eigenen Platz in der Welt und in der Gesellschaft auseinandersetzen. Das macht natürlich jeder auf seine eigene Art. Und die Arbeit des Lesers oder des Schauspielers besteht immer darin, herauszufinden, was man selber mit der Beschreibung dieser Dissonanz anfangen kann. Max Frisch ist in «Stiller» einfach wahnsinnig vielschichtig. Mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen der Roman erzählt wird. Von Stiller, von meiner Figur (Rolf), von Julika oder der Ehefrau Sybille. Oder von den Fantasiegespinsten, die Stiller beispielsweise in Amerika entwirft. Das ist alles ein Ausdruck der Sehnsucht nach einem anderen Leben, nach einem anderen Ich. Und da kann man sich richtig schön abarbeiten an diesem Roman.
Wo wir von «sich zuhause fühlen» sprechen: Du wurdest in Berlin geboren, bist in Zürich und Hamburg aufgewachsen, und lebst mittlerweile mit deiner Familie in Berlin.
(lacht) Und jetzt seit einem Jahr in Wien. Wir sind schon wieder umgezogen. Aber ich komme auch nicht mehr wirklich nach.
Neben «Zwingli» spielt auch dieser Film in Zürich. Du hast in Zürich gelebt. Was hast du für eine Verbindung zu dieser Stadt?
Da sind viele Kindheitserinnerungen. Ich habe auch jetzt noch Familie in Zürich und arbeite oft hier. Wenn wir jetzt von «Zwingli» und «Stiller» ausgehen, dann sind das Geschichten, die eben hier spielen. Und es ist unbezahlbar, wenn man einen persönlichen Zugang zu den Geschichten hat, die man erzählt. Das kann man nicht nachholen. Das ist Teil meiner Biographie. Und für einen arbeitenden Künstler ist das wichtig, dass ich diesen Zugang zu Geschichten habe, die ich mir im besten Fall aussuche oder bearbeite. Und das gilt durch meine Vergangenheit für Schweizer Geschichten sowieso, und für Zürcher Geschichten eben noch mehr. Man hat ein anderes Anliegen, einen anderen Sprechanlass, Geschichten von sich zu erzählen.
 Max Simonischek in seiner Rolle als Staatsanwald Rolf Rehberg. (© 2025 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.)
Max Simonischek in seiner Rolle als Staatsanwald Rolf Rehberg. (© 2025 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.)
In «Am Hang» spieltest du einen Anwalt, in «Friedas Fall» einen Verteidiger und jetzt, in «Stiller», einen Staatsanwalt. Alles eher wollwollende Figuren, die in der Justiz tätig sind. Sind diese Rollen Zufall oder hattest du in der Jugend ein Interesse an Jura?
Ich bin jetzt wirklich erstaunt. Ich war mir des juristischen Aspekts gar nicht so bewusst, und der ist mir eigentlich ziemlich egal. Bei «Stiller» waren es jetzt nicht die juristischen Fragen, mit denen ich mich befasste. Auch meine Figur, Rolf, hat ja ein Doppelleben und hat Sehnsüchte – ähnlich wie die des Stillers. Er lebt das Familienleben, aber er betrügt seine Frau und sehnt sich nach was Anderem. Das sind ja die Themen, egal ob er Anwalt ist oder Tankstellenwächter oder Bäcker. Das sind die Konflikte, die erlebenswert sind. Wenn man an «Akte Grüninger» denkt, war ich auch nicht unbedingt der Gute. Es sind eher die inneren Konflikte und Themen, die die Figuren auszeichnen, und die hängen nicht immer mit ihrer Profession zusammen. Ich suche mir das nicht nach dem Beruf der jeweiligen Figur aus.
Eine Figur ist ja mehr als ihr Beruf.
Absolut. Was ist eine Figur? Eine Figur setzt sich aus verschiedenen Situationen zusammen und wie sie sich in diesen Situationen verhält. Da kann sich ein Anwalt natürlich genauso verhalten wie ein Fussballspieler.
Das Buch hat so viele verschiedene Ebenen und Zugänge, dass man als Leser irritiert ist und sich nicht mehr auskennt. Wie transportierst du das in einen Film, der bebildert werden muss?
Bei «Stiller» geht es ein stückweit ja auch darum, dass man auf seinen erlernten Beruf festgenagelt wird. Quereinsteiger werden in der Schweiz ja noch immer nicht so gerne gesehen.
Wir stecken überhaupt gerne in Schubladen. Der da ist so, und der dort ist so einer. Das ist das, was du eingehend formuliert hast mit der Konformität. Und ich verstehe absolut, dass man dagegen aufbegehrt. Und ich finde auch, dass der Film etwas dagegen aufbegehrt. Mit den Zeitsprüngen, den Ebenensprüngen und mit der Farblichkeit. Es ist nicht alles logisch erklärbar. Beispielsweise, warum die eine Rückblende schwarzweiss und die andere farbig ist. Also da gibt es auch einen anderen emotionalen und inhaltlichen Zugang als nur das Lineare. Dieses Nichtperfekte ist schön. Denn mir scheint, unsere menschliche Natur strebt immer nach dem Erklärbaren.
Ist dies vielleicht eine weitere Ebene des Films? Dass man sich bewusst gesagt hat: «Wir gehen anders vor, als es andere Produktionen tun würden»?
Also ich würde sagen, da hat Stefan Haupt den Roman ernstgenommen. Weil der Roman lebt ja auch davon, dass oft nicht klar ist, ob er (White) nun doch er (Stiller) ist oder nicht. Ob Rückblenden echt sind oder doch nur Fantasie. Das Buch hat so viele verschiedene Ebenen und Zugänge, dass man als Leser irritiert ist und sich nicht mehr auskennt. Wie transportierst du das in einen Film, der bebildert werden muss? Du musst Stillers Gesicht ja sehen können. Dort fängt für mich Kunst an; wenn man assoziativ arbeitet. Und dieses Brechen mit Sehgewohnheiten finde ich sehr gelungen. Weg von den Trampelpfaden.
Abschliessende Frage: Wie unterscheiden sich Drehs in Deutschland von Drehs in der Schweiz?
Das Essen ist der Schweiz ist viel besser. Aber darauf zielt deine Frage nicht ab. Als Schauspieler steht man immer vor dieser Schwelle, sich emotional zu öffnen. In jedem Film erzählst du ja auch ein Stück von dir, öffnest dich einer fremden Umgebung, und vertraute Gesichter helfen da sehr. Etwa die Regie oder der Kameramann. Man muss sich so eine Szene alles andere als intim vorstellen, weil überall Leute sind. Und wenn du mit denen bereits ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, fällt es leichter, von dir zu erzählen, als wenn das alles Fremde sind. Das ist einer der Vorteile der Schweiz, weil es hier sympathischerweise gefühlt drei Kameraleute und vier Maskenbildner gibt. Das ist gut für unsere Arbeit.
Das Interview wurde am 28. September 2025 im Rahmen des Zürich Film Festivals im Dolder Grand in Zürich geführt.