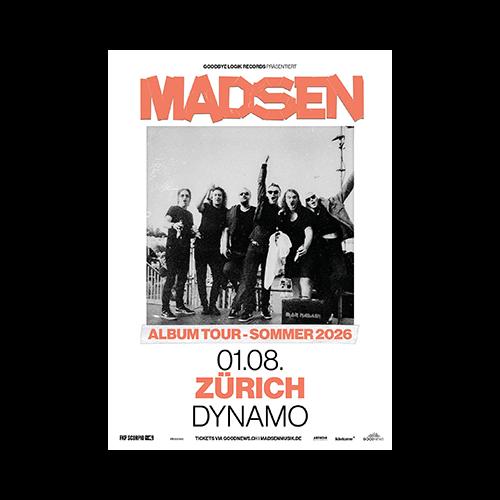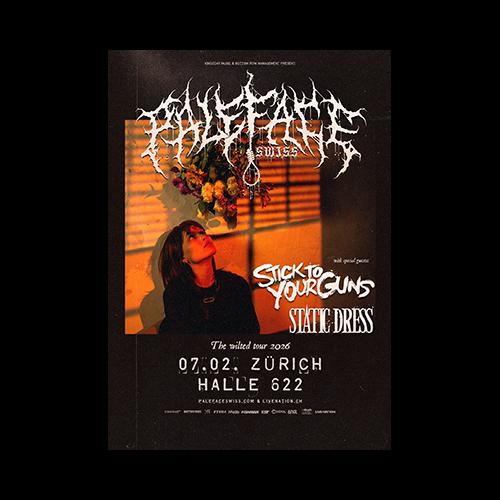Viel Rauch um die Sisters of Mercy
Nach eher kühlen Tagen läutete die Band Sisters of Mercy am 21. Mai im X-TRA endlich mal warme Tage ein. Ein Lebenszeichen der Kult-Band der 80er, doch leider auch nicht wirklich viel mehr. Viel Rauch um nicht allzu vieles, um nicht sagen zu müssen, um nichts. Doch fangen wir von vorne an.
Eine Band, die seit über 20 Jahren kein neues Album mehr aufgenommen hat, und es mit ihrem düster melancholischen Sound dennoch schafft, hunderte Menschen ans Konzert zu locken. Das muss doch Kult sein. Schwarz gekleidete, in Lack und Leder gewandete und bleich geschminkte Fans. Gruftis, «Normale», Junge und Alte. Das Publikum war breit gemischt. Ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Erinnerungen an meine Jugendzeit werden wach und kommen hoch. In meiner alten Heimat im Kreis 4 und 5 angekommen, fühlte ich mich gleich wohl. Und meine Spannung auf die Schwestern stieg. Ich durchforstete meine Erinnerungen. Nebel, ächzende theatralische Stimme, psychedelisch punkiger Elektro-Sound. So ungefähr habe ich die Sisters of Mercy in Erinnerung. Ganz gespannt betrat ich die Vorhalle vom X-TRA. Dunkle, basslastige Gitarrenklänge drangen bis zu mir durch. Es klang vielversprechend. Was ich dann sah und zu hören bekam, war einfach der Wahnsinn. Die Vorband Losers leistete vollen Einsatz. Ihr alternativer, rockig-punkiger New Wave Sound mit einer genialen, aber einfachen, melancholisch angehauchten Videoshow, gefiel dem Publikum. Sie machten als Vorband den Sisters of Mercy wirklich alle Ehre.
Pompöser Start, danach destruktive Langeweile
Während sich die Halle mit immer mehr Fans füllte, gingen die Umbauten auf der Bühne recht zügig voran. Als dann die Nebelwerfer aufgetankt und in Stellung gebracht worden waren, konnte es losgehen. Alles war bereit für das Gastspiel einer der stilprägendsten Bands der letzten Jahrzehnte. Nebelschwaden stiegen zur Melodie von «Afterhours» auf, zwei Gitarristen (Chris Fatalist und Ben Christo) betraten die Bühne und brachten ihre Gitarrenklänge zum Besten. Auf einmal, ganz plötzlich, ein oranges Laser-Licht-Spektakel. Im Nebel versank die ganze Bühne. Nur noch Rauchschwaden waren zu sehen und zu riechen. Das Publikum tobte, während langsam der legendäre Frontmann Andrew Eldritch durch den Nebel die Bühne betrat. «Crash and Burn» sang er mit schriller, quiekend-heiserer Stimme ins Mikrofon. Die Stimmung stieg, das Publikum feierte seinen Gothfather of Goth, ein Titel, den Eldritch nur widerwillig trägt.
Nach diesem doch sehr vielversprechendem und pompösen Start kehrte schon bald destruktive Langeweile ein. Immer wieder zogen schwere Nebelschwaden auf, umhüllten die Bühne und die komplette Band. Ich zweifelte, ob immer alles live war. Zwar bedienten sie sich mit Songs aus ihrer Bandgeschichte, aber es war an Eintönigkeit kaum zu überbieten. Trotzdem verstanden die Sisters es irgendwie, ihre Musik aus hartem Rhythmus des Drum-Computers, rockigen Gitarren und dem Gesang von Eldritch live umzusetzen. Bei den Songs verliessen sie sich auf altbewährtes Material. Nach gut einer Stunde fühlte man sich von der konstanten Lethargie ziemlich zermürbt. Doch zum Glück steigerte sich dann das Konzert wieder von Song zu Song. Und am Ende kamen doch noch die unvergesslichen Hits wie «This Corrosion» und «Tempel of Love». Ein krönender Abschluss.
Das Erlebnis: eine Legende, ein Mythos. Zwar ohne Haare, aber immer noch mit Brille und seiner rauen-schrillen Stimme. Es war nicht das beste oder genialste Konzert. Doch schafften es die Sisters of Mercy zum Schluss hin alles nochmals zu kehren und aus vergangenen Zeiten doch noch etwas rüberkommen zu lassen. Zufrieden über den doch gelungenen Abend zog ich von meiner alten Heimat zurück in mein Zuhause. Ein bisschen still und nachdenklich liess ich bei der Heimreise den Abend Revue passieren. Und ich stellte fest: Die Dinge mögen sich ändern, wir werden älter. Nichts bleibt für immer. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn nur so schaffen wir Platz für Neues. Neues wie die Band Losers, die man sich unbedingt im Gedächtnis behalten sollte. Und so haben es eben die Sisters of Mercy zum Schluss doch geschafft. Das typische für die Band, die düstere mystische Atmosphäre, die knorrig-schaurige Stimme Eldritchs und Doktor Avalanch, der Drum-Computer, den Mythos und die Legende zu erhalten.