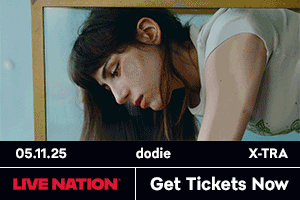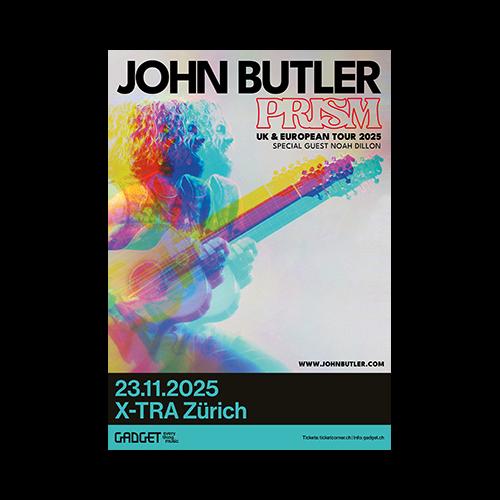Awkwafina wirkt trotz asiatischem Aussehen fremd in China.
Seit der Premiere am Sundance Film Festival sammelt Filmemacherin Lulu Wang konstant Lob für ihr Familiendrama «The Farewell». Am Zürich Film Festival nahm sich Lulu Wang Zeit, um mit Bäckstage ihre persönlichen Erfahrungen als Immigrantin in New York, als Asiatin in Hollywood und als Pianistin am Filmset zu diskutieren. Herausgekommen ist ein sehr spannendes Interview mit einer der vielversprechendsten Künstlerinnen des Jahres.
Wie viel von dir persönlich steckt in deinem Film?
Sehr viel! Der Film ist sehr persönlich für mich. Er basiert auf meiner eigenen Familiengeschichte. Der Teil in China spielt in der Heimatstadt meiner Grossmutter. Der Film beruht auf meiner Beziehung zu meiner Grossmutter, aber auch auf den Erfahrungen als Emigrantin, weit weg von zu Hause. Und der Film handelt selbstverständlich davon, seinen Platz auf der Welt zu finden. Als ich den Film schrieb, befand ich mich selbst mitten in der Postproduktion meines Erstlings («Posthumous» mit Jack Huston und Brit Marling in den Hauptrollen, Anm. d. Red.) und war nervös, wusste nicht, ob es ein Erfolg werden würde und ob, ich weiterhin Filme machen kann. Und ich fragte mich wie ich all diese Ängste vor meiner sterbenden Grossmutter verstecken soll, wenn ich sie zum letzten Mal besuchen gehe.
Warum hast du dich bei deinem Zweitling dazu entschieden, eine Familiengeschichte aufzunehmen?
Ich ging an keine Filmhochschule, mein Erstling war in gewisser Hinsicht mein «Ausbildungsfilm». Nach «Posthumous» realisierte ich, dass ich eine persönliche Geschichte erzählen wollte und da ich meine Familie als sehr lustig und schräg empfinde, war es klar, dass es von ihnen handeln muss. Und dann wurde meine Grossmutter krank und wir reisten nach China, um die Hochzeit meines Cousins auf die Beine zu stellen. Dies empfand ich als sehr typisch für uns und nahm es als Thema auf. Es zeigt, wie meine Familie tickt. Ich konnte viele Themen erkunden, meine Beziehung zu meiner Familie, zu China, die Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Wertevorstellungen.
Welches Reaktionen zum Film haben dich berührt?
Viele junge Asiatinnen weinen in den ersten fünf Minuten des Films. Einerseits weil sie die Grossmutter sehen, andererseits weil sie Menschen sehen, die ihnen ähnlich sind vom Äusseren und die ihre Sprache sprechen. Der Film trifft den Nerv vieler, die zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind. Und dieses Publikum merkt nun, wie wenig solcher Geschichten wir im Kino sehen. Dies gilt auch für mich. Ich kann chinesische Filme schauen, mit Menschen, die aussehen wie ich, aber deren Kultur mir entfremdet ist, oder ich sehe US-Filme mit Menschen, die nicht so aussehen wie ich und die nicht den gleichen Hintergrund haben wie ich.
Wie hat deine Familie auf den Film reagiert?
Meine Familie hat immer das Gefühl, ich mache meine verrückten Projekte. Die erste Frage meines Vaters lautet immer «Wirst du auch entlohnt dafür?». Er hat sich für mich gefreut, da ich so meine Miete zahlen konnte, aber hat sich ansonsten nicht viel dabei gedacht. Und dann bat ich ihn, mein Drehbuch zu lesen und mir zu sagen, ob es auch authentisch ist. Er meinte dann ganz verblüfft, dass es sehr authentisch ist und gar nicht viel passiert. Er befürchtete, die Zuschauer würden sich langweilen. Meine Eltern sahen den fertigen Film zum ersten Mal am Sundance Film Festival mit allen anderen Zuschauern, die lachten und weinten. Und da wurde ihnen bewusst, dass andere Personen sich mit unserer Geschichte verbunden fühlten.
Was war dir bei der Hauptfigur Billy wichtig?
Es war mir wichtig, dass sie amerikanisch rüberkommt. Ich wollte jemanden, den man sofort als New Yorkerin identifiziert. In Filmen sehen wir das überhaupt nicht, aber es gibt sehr viele Asiaten in New York. Asiaten, die in New York geboren und aufgewachsen sind. Beim Casting war es mir wichtig, jemanden zu finden, der diese Essenz besass. Jemand, der in China fehl am Platz wirken konnte, obwohl sie äusserlich eine Asiatin ist. Bei Awkwafina habe ich diese Eigenschaft gefunden. Die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie sie spricht, ist sehr casual, sehr amerikanisch. Und auch wie sie sich anzieht, dieses monochrome Schwarz und Grau. Der Rest der Familie kleidet sich viel farbenfroher.
Konntest du mit dem Film neue Ansichten über deine chinesischen Wurzeln gewinnen? Über östliche Traditionen?
Es ging weniger darum neue Ansichten zu gewinnen, als zu verstehen, was und wie viel ich von der chinesischen Kultur verstehe. Meine Mutter hat beispielsweise schon beim ersten Drehbuchentwurf gemeint, ich verstehe sehr wenig über China. Sie wollte mir nochmals alles erklären und ich habe sie höflich darauf hingewiesen, dass dies ebenso sein muss. Billy soll nicht alles wissen. Zumal meine Mutter ja mehr als 30 Jahre Zeit hatte, es mir zu erklären und falls ich es immer noch nicht raffte, sollten wir es besser sein lassen (lacht). Aber meine Mutter insistierte, dass ich die Politik zu wenig verstehe, die Konflikte zwischen Nord- und Südchina und die Kommunistische Partei und so weiter. Sie meinte auch, ich färbte ein zu schönes Bild meiner Grossmutter. Ich wurde von meiner Grossmutter sehr umsorgt, aber auch deshalb, weil ich die Enkelin bin und nicht die Schwiegertochter. Als letztere hatte meine Mutter immer ein schwieriges Verhältnis mit meiner Grossmutter. Und mein Film wird aus der Perspektive der liebenden Enkelin erzählt, es ist eine subjektive Wahrnehmung. Klar gibt es die Spannungen zwischen meiner Grossmutter, die in der kommunistischen Partei kämpfte, und meiner Mutter, die als Intellektuelle viel schrieb. Für mich bleibt meine Grossmutter aber meine Grossmutter.
«The Farewell» erzählt trotz der Schauplätze New York und China eine universelle Geschichte.
Das stimmt. Als Storyteller kann ich mir nicht immer Gedanken darüber machen wie jeder einzelne die Geschichte wahrnimmt. Meine US-Produzente haben bei vielen Szene gemeint, dass hier und dort die Erklärung fehlt und ich noch ausholen muss. Aber ich wehrte mich dagegen. Als ich in den USA aufwuchs, sah ich dauernd Filme mit anderen Traditionen wie Thanksgiving und ich lernte darüber – nicht, weil mir eine Person im Film darüber Auskunft gab, sondern indem ich der Handlung im Film folgte. Beim Reisen begeben wir uns oft in ähnliche Situationen, wir lernen beim aufmerksamen Beobachten. Und ironischerweise wird der Film, die Geschichte, umso universeller, je spezifischer die Handlungselemente sind. Ja, in China wird am Mittag geheiratet. Je generischer erzählt wird, desto weniger authentisch ist es. Ist die Authentizität weg, vergeht auch die Verbundenheit. Ohne Verbundenheit können wir wiederum keine universellen Geschichten erzählen.
Gilt der Tod in China auch als Tabuthema, wird deshalb nicht offen darüber gesprochen?
Nein, es geht vielmehr um die Körper-Geist-Verbindung, die sehr viel Gewicht hat. Wenn die Grossmutter erfährt, dass sie krank ist, wird sie denken, sie stirbt und diese Gedanken führen dann dazu, dass sie sterben wird. Aber wenn du daran glaubst, dass es dir gut geht, wird es dir wohl auch gut gehen.
Die Vertretung von Frauen vor, aber auch hinter der Kamera, ist ein sehr aktuelles Thema. Als Frau und Asiatin, hast du gemäss Statistiken doppelt schlechte Karten. Wie bist du damit umgegangen und was hast du gelernt?
Zunächst mal meine Erfahrungen als Asiatin. Als ich den Film pitchte waren alle verwirrt. Ist es ein US- oder ein China-Film? Und ich fragte sie, was sie über mich denken. Bin ich eine Amerikanerin oder eine Chinesin? Es kann kein chinesischer Film sein, da die Erzählperspektive amerikanisch ist. Aber es kann auch kein US-Film sein, weil meistens Mandarin und nicht Englisch gesprochen wird. Es war sehr aufwendig meine Vision des Films rüberbringen zu können, weil die meisten den Film in eine Schublade stecken wollten. Ein anders Beispiel ist, dass die Produzenten häufig Änderungen haben wollte, weil ihnen etwas nicht passte oder sie es nicht verstanden. Die Mutterrolle als Beispiel, war ihnen zu wenig einfühlsam und sie wollten, dass sie softer wird und Umarmungen gibt. Für mich passte dies nicht, weil meine Mutter halt nicht der sanfte Typ ist. Für US-Produzenten war es unvorstellbar, eine taffe Mutterrolle zu zeigen. Nun da der Film draussen ist und funktioniert, sehen sie es anders. Als weibliche Filmemacherin werde ich nunmehr vermehrt gefragt und beobachtet wie ich Frauenfiguren zeichne. Was gut ist und den Diskurs ankurbelt, jedoch sollten auch weisse, männliche Filmemacher mit diesen Fragen konfrontiert werden. Auch sie tragen hier eine Verantwortung und Bewegungen wie Time’s-Up machen nur Sinn, wenn alle Geschlechter und Ethnien ihre Verantwortung wahrnehmen. Wenn mich Menschen zum ersten Mal sehen, sind sie überrascht, wie gut ich Englisch spreche, weil sie davon ausgingen, dass ich keine Amerikanerin bin. Obwohl Amerika ein Land der Einwanderer ist, herrscht in vielen Köpfen ein sehr spezifisches Bild und dieses gilt es mit der Kunst zu durchbrechen und die Realität zu zeigen, indem eine korrekte Repräsentation wiedergegeben wird. Und obwohl Medien den Kulturwandel unterstützen, werden vermehrt Fragen zur Ungerechtigkeit an weibliche Filmemacher gestellt. Doch als Künstlerin möchte ich auch übers Casting, über die Kamerafrau und so weitersprechen, nicht nur über Politik.
Du hast vorhin von der taffen Mutter gesprochen. Wie ehrgeizig war die Erziehung deiner Eltern?
Sehr chinesisch, sehr asiatisch und sehr Immigrantenfamilien-like. Ich denke viele Immigrantenkinder machten genau dasselbe durch wie ich. Die Eltern opfern viel auf, weil sie eine bessere Zukunft für ihre Kinder haben möchten und die Kinder wachsen unter einem starken Erfolgsdruck auf. Und als Kind möchtest du dazugehören, Freunde treffen, Blödsinn machen und dies passt dann nicht immer gut zusammen.
Die Kameraarbeit und auch die klassische Filmmusik zeichnen den Film aus und unterstützen das Drehbuch optimal. Wie bist du hier vorgegangen, welche Anweisungen waren wichtig?
Meine Kamerafrau Anna Franquesa Solano hat ein sehr gutes Auge und wir sprachen viel über das visuelle Storytelling. Die ganze Familie führt ja de facto ein Theaterstück zugunsten der Grossmutter auf, und dies wollten wir auch visuell untermauern. Wir haben deshalb in diesen Szenen eine stärkere Beleuchtung eingesetzt als sonst. Als klassisch ausgebildete Pianistin habe ich mit dem Filmkomponisten Alex Weston viel zusammen ausprobiert. Ich wollte die klassische Musik dazu nutzen, die inneren Gefühle der Protagonisten ausdrücken, da sie diese Gefühle entweder nicht aussprechen oder nicht zeigen dürfen. Durch die Musik können sie weinen.
Inwiefern hilft dir deine Erfahrung mit der klassischen Musik beim Filmemachen, ausser den oben erwähnten Punkten?
Ich habe seit ich vier Jahre alt bin Piano gespielt. Meine Eltern waren immer gut darin, mir Schuldgefühle einzureden, falls ich mal mit den Gedanken spielte, aufzuhören. Im Sinne von «wir haben auf viel verzichtet, um dir ein Piano schenken zu können, also nutze es» und so weiter (lacht). Es lernte mich Disziplin. Wenn du etwas nicht magst, wirst du trotzdem jeden Tag besser dank der Übung. Beim Schreiben ist es ähnlich. Du musst dich niedersetzen und schreiben, schreiben, schreiben. Das Klavierspiel brachte mir auch ein gutes Gefühl von Rhythmus bei. Pianissimo, Fortissimo, Allegro! Ich habe viel davon im Film genutzt. Der Film hat Elemente der Oper.
Die Filmkritik zu «The Farewell» findest du hier.