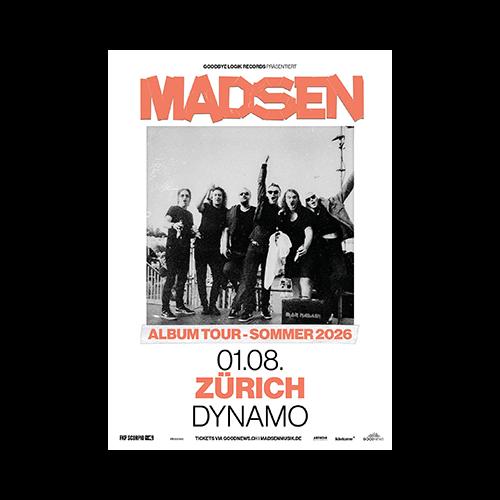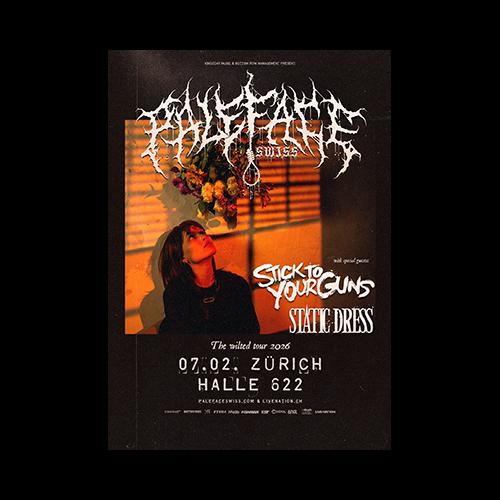«An Sehenswürdigkeiten kann ich meinen Blick nicht erneuern»
Roger Willemsen gilt als einer der weitgereistesten Intellektuellen Deutschlands. In seinen Büchern schreibt er über die Enden dieser Welt. Am Openair Literaturfestival in Zürich entführte er das Publikum mit schillernden Geschichten auf eine Reise rund um den Globus. Im Alten Botanischen Garten erzählte Willemsen von fremden Ländern und Kulturen. Auf welchen Wegen er den Stoff für seine Reisegeschichten sammelt, hat er Bäckstage im Interview verraten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, «Die Enden der Welt», der Blick von Reisenden verfremde die Fremde. Wie bewahren Sie in der Fremde einen unverklärten Blick?
Ich bevorzuge Räume, die nicht im Bereich der Sehenswürdigkeiten liegen. Denn an Sehenswürdigkeiten kann ich mich nicht abarbeiten, weil ich meinen Blick kaum mehr an ihnen erneuern kann. Die höchste Differenzierung von Räumen ist häufig an den Stadträndern zu finden. An den verfallenen Bauten, den übersehenen Gegenden, den Wartehallen. Ich gehe gerne dorthin, wo die Leute wirklich leben. Ich versuche nicht als Betrachter zu erscheinen, sondern als jemand, der die mutmassliche Position dessen einnimmt, der immer hier ist.
Wie nehmen Sie die Position des Einheimischen ein?
Ich mache dann immer dasselbe. An den immer gleichen Orten setze ich mich an denselben Tisch, esse dieselben Sachen und irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich unter dem Radarschirm bin. Die Leute denken, der gehört zum Inventar. Dann ergibt sich eine eigene Beobachterperspektive, in der man das Gefühl hat, das Beobachten verändert den Ort nicht mehr.
Gelingt das immer?
An den Orten, die touristisch sind, kann das nicht mehr gelingen, weil man da ohnehin eine kommerzielle Grösse ist. An der Peripherie hingegen ist die Schwierigkeit, dass man auffällt, weil sonst keine Fremden da sind. Das ist mir auf einer Reise durch Chile passiert. Ich wollte ein paar Nächte in San Pedro De Atacama bleiben. Als ich da ankam, stellte sich heraus, dass meine Freunde das Hotel zwar gebucht hatten, es sich jedoch in Kalifornien befand, weil es da auch ein San Pedro gibt. Da blieb mir nichts anderes übrig, als mit meinem Fahrer wieder zurückzufahren und mich irgendwo am Wüstenrand in einem kleinen Hotel niederzulassen. An diesem Ort gab es keine Touristen, nur ab und zu ein paar Konferenzgäste. Ich habe tagelang da gelebt. Von den Einheimischen hat wohl niemand begriffen, was der Fremde hier machte, es gab ja nichts zu sehen. Aber da war ich so gerne, weil es so wesenlos war. So unakzentuiert, so übersehen war dieser Ort wie bei uns Mönchengladbach. So Orte, in denen niemand bleibt und niemand gewesen sein will, niemand Ferien macht. An solchen Stellen befinde ich mich manchmal gerne.
Individualtourismus ist trendy. Lonely Planet hat ihn massentauglich gemacht. Kann man heute Orte noch in ihrer Ursprünglichkeit bereisen oder ist das ein Widerspruch in sich?
Das ist ein Widerspruch. Als ich 1993 in Timbuktu war, da war das für mich ein legendärer, magischer, sagenumwobener Ort. Und was hatte die deutsche Regierung diesem Ort geschenkt? Ein Internetkaffee. Ich ging da rein, setzte mich an einen Rechner und fand nur Pornographie. Ich dachte mir: Du bist an dem entlegensten Ort voller Sahara, einem alten Kulturort, der allerersten Universitätsstadt auf dem afrikanischen Kontinent und alles was wir diesen Leuten anzubieten haben, ist das. Beinahe überall auf der Erde ist das Internet die Matrize, in die alles läuft. Ich glaube, dass wir uns ähnlicher werden, indem wir bestimmte Grundmuster aus dem elektronischen Überbau übernehmen.
Weshalb sollte man überhaupt noch reisen? Man kann sich andere Länder ja auch übers Internet anschauen.
Weil es viel zu riechen, zu schmecken, zu riskieren gibt. Weil der ganze Körper auf Reisen exponiert ist, wie er das sonst sehr selten ist. Sei es durch Nahrungsmittel, Verkehrsmittel, Brutalität. Erfahrungen muss man dreidimensional machen. Das blosse Überfliegen reicht nicht, man muss schon mittendrin sein.
Gibt es auch Reiseerlebnisse, die Sie nicht öffentlich machen? Orte, die Sie nicht teilen möchten?
Ja, ich habe ein paar Orte, über die ich nicht schreibe. Weil ich mich selber dahin zurückziehe und weil ich möchte, dass sie so undefiniert und ursprünglich bleiben. Ich habe früher mal für Dumont, einen Kunstreiseführer, geschrieben. Das war eine Arbeit, die sehr für den Reisenden war. Damals habe ich mich auch darum bemüht, ein paar Orte, die ich besonders mochte, für mich zu behalten. Denn man kann sich nicht wünschen, dass da irgendwann Trampelpfade durchführen.
Was macht für Sie den Reiz eines Openair-Literaturfestivals aus?
Die offenen Räume sind atmosphärisch dichter, verleiten jedoch zum Abschweifen. Unter freiem Himmel vom Reisen zu erzählen, passt aber hervorragend. Man nimmt alle Geräusche auf, die man hören kann, so entsteht eine Festatmosphäre, die ans 18. Jahrhundert und an die Gartenfeste erinnert.
Sie haben das Programm «Das mir. Roger Willemsens Reiseerzählungen» extra für heute Abend zusammengestellt. Haben Sie es speziell an das Schweizer Publikum angepasst?
Nein, das käme mir merkwürdig vorurteilsbeladen vor. Ich habe Barbra Streisand mal hier in Zürich gesehen und musste ihr Konzert für «Die Zeit» rezensieren. Ich fand es so furchtbar, dass sie sich vorher eine Checkliste gemacht hat, was alles schweizerisch ist. Es müssen die Schokolade und die Uhren vorkommen und die Langsamkeit und das «li» hintendran, das kommt mir schon fast rassistisch vor.
Sie sind Meister des Beschreibens. Wie würden Sie die Schweiz in wenigen Worten charakterisieren?
Die gesellschaftliche Betriebstemperatur hat eine grössere Wärme als in Deutschland. Die Achtsamkeit aufeinander, die Art wie Kommunikation betrieben wird, ist behutsamer. Ineffizienter im positiven Sinne, es wirkt weniger ökonomisch. Wenn ich mir das Zürcher Kulturleben anschaue, gibt es hier eine viel höhere Meinung vom Wort, vom Denken und den Ideen als in Deutschland. Bei uns lässt sich viel mehr auf ökonomische Verhältnisse reduzieren. Auf der anderen Seite leidet die Schweiz an den Symptomen ihres mangelnden Selbstbewusstseins. Dies zeigt sich durch eine teilweise starke Aversion gegen die Deutschen, die nicht souverän ist, sondern aus einem Minderwertigkeitsgefühl kommt. Da denke ich oft: Schweizer, helft mir doch mit meiner Kritik an Deutschland, aber eben selbstbewusster.